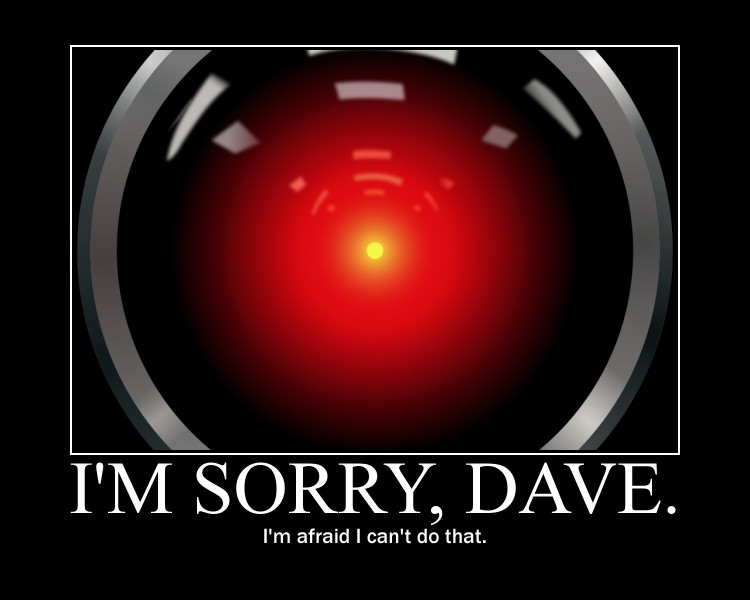mg210316
Science-Fiction Filmkunst
In Kunst
Erstellt am: 21. März 2021
Von Manfred Goschler

Wissenschaftliche Themen mit ihren Grenzenbereichen verfolge ich gerne in populärwissenschaftlichen Sendungen, gerade wenn es gelingt, komplizierte Sachverhalte auch einem Laien näherzubringen. Ebenso spekuliere ich gerne über diese Grenzen hinweg und über zukünftige Entwicklungen und greife dazu auch auf Produkte der Kunst, wie Literatur oder Film, zurück. Obwohl ein Buch im Vergleich zum Film, der Phantasie mehr Freilauf lässt, kann der Film durch seine optische und akustische Gestaltung beeindrucken. Grundsätzlich muss ich aber einräumen, dass ich (Kino)Filme eher weniger im Kino sehe, wo sie zeitnah aufgeführt und wahrscheinlich auch am besten ihre Wirkung entfalten können. Da mich manche Kinofilme eines zugeordneten Genres allerdings nicht überzeugt hatten, hat es oft ein oder zwei Jahre gedauert, bis ein solcher Kinofilm den Weg über das Fernsehen zu mir gefunden hat, manchmal auch viel länger. Nichtsdestotrotz haben mich einige Filme wirklich beeindruckt, insbesonders, wenn sie in Bezug zu ihrer Erstellungszeit betrachtet werden. Hierzu möchte ich Überlegungen anstellen, die mit einem Besuch von uns 2013 in Hollywood beginnen sollen.
Hollywood als Traumfabrik
Hollywood, auch ein Synonym für die Filmindustrie, hat uns bei unserem Besuch im Jahr 2013 einige seiner Facetten gezeigt und wir haben etwas über ihre virtuelle Produkte der „Traum“- Fabrik und ihren Beteiligten dazugelernt. Angefangen mit der Stummfilmzeit, waren uns viele Filme mit ihren Stars bekannt. Es waren Unterhaltungsfilme, die uns gerade als Kinder begeistern konnten und die uns oft in Phantasiewelten führten. Einen Spielfilm sehen verbunden mit einem Kinobesuch, oder auf einem Fernseher, der Mitte der sechziger Jahren nur zwei Empfangskanäle hatte, war natürlich schon ein Highlight. Wie die ersten übertragenen Stummfilme, die in einer Zeit gedreht wurden „als die Bilder laufen lernten“, wie es auch auf einigen Untertiteln zu lesen war.
Film als komplexe Form der Kunst
Der Film tritt als wichtigstes Massenmedium, als Wirtschaftsfaktor und als eine Kunstform auf (vgl. Wikipedia). Im Vergleich zu anderen Kunstgattungen, wie z.B. die Malerei oder Fotographie, ist diese Gattung allerdings wesentlich komplexer. Durch die zeitliche Abfolge von Einzelbildern, die noch akustisch durch Töne oder Musik untermalt werden können, eröffnen sich unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl inhaltlich als auch darstellerisch. Eine Einteilung dieser Filme in Genres wie z.B. Kriminalfilm, Komödie, Kriegsfilm, Liebesfilm, Science-Fiction-Film, Horrorfilm usw. ist heute schwieriger als in der Vergangenheit, da Inhalte oft mehreren Genres zuordenbar sind. Was aber nicht verwundert, sollen doch gerade die Blockbuster ein großes Publikum erreichen, um den wirtschaftlichen Betrieb der Filmfabrik aufrechtzuerhalten.
Verbreitung und technische Entwicklung des Films
Mittlerweile ist das Angebot an Filmen, welches natürlich weit über die Kinospielfilme hinausgeht und seine Verbreitung, kaum mehr für einen Laien überschaubar. Hunderte von Empfangskanälen, die von verschiedenen öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern angeboten werden, sind heute fast schon Standard und können darüber hinaus noch weiter ergänzt werden. Diese Filme können über verschiedene Netzwerke auf unterschiedlichste Weise auf hochauflösende Empfangsgeräte gebracht werden. Dies ermöglicht nicht nur realistische Bilder, die von einer ansprechenden Akustik untermalt werden kann, sondern geht teilweise über eine Realität hinaus, wie sie ein Mensch mit seinen natürlichen Sinnen erfassen kann. Z.B. wenn eine Bewegung in Zeitlupe gezeigt wird wie der Flügelschlag eines Kolibris. Oder umgekehrt, ein zeitlicher Verlauf beschleunigt wird wie Bewegungen der Gestirne.
Science Fiction
Das Vorwort suggeriert eine Verbindung zur Wissenschaft, gefolgt von der „Fiction“, die auch für Unterhaltungsfilme charakteristisch sein sollte. Deshalb interpretiere ich diesen Begriff und das Genre Science Fiction als einen Bereich, der idealerweise wissenschaftliche und technische Betrachtungen berücksichtigt und mit viel Phantasie ansehen darf, die auch weit entfernt von Realität sein kann. Es darf also, aus welchen Gründen auch immer, über zukünftige Entwicklungen spekuliert werden.
Zum Vergleich im Duden Online unter Bedeutung(2): Bereich derjenigen (besonders im Roman, im Film, im Comicstrip behandelten) Thematiken, die die Zukunft der Menschheit in einer fiktionalen, vor allem durch umwälzende Entwicklungen geprägten Welt betreffen.
Ich lasse mich gerne von Sci-FI Filmen unterhalten, gerade wenn wissenschaftliche Themen aufgegriffen werden und ihr Inhalt halbwegs konsistent und nicht zu absurd erscheint. Dann kann diese Form der Unterhaltung durchaus anregend sein, um über technische Möglichkeiten und Entwicklungen zu spekulieren und persönliche Grenzlinien des Glaubens auszuloten. Oft ist es nicht der Film als Ganzes, der beeindruckt, sondern bestimmte Facetten, wie inhaltliche Teilaspekte oder Darstellungsformen. Science Fiction bietet ein breites Themenspektrum von denen ich Maschinen und deren Verhältnis zum Menschen herausgreifen möchte. Insbesondere moderne Maschinen, wie es Computerprogramme, intelligente Maschinen und ihre Mischformen sein können. Die folgende Auswahl kann weder repräsentativ noch vollständig sein, sondern ist eher beispielhaft gedacht.
Kürzlich konnte ich den Stummfilm „Metropolis“ aus dem Jahre 1927 von Fritz Lang sehen, der vorübergehend zum Abruf in einer öffentlich-rechtlichen Medienbibliothek stand. Dieser Film, der auf einem Roman von Thea von Harbou aus dem Jahre 1925 beruht, zeigt eine Zweiklassengesellschaft in einer futuristischen Großstadt, wo Maschinen für fragwürdige Zwecke benutzt werden. Menschen aus einer Unterschicht müssen unter menschenunwürdigen Bedingungen den Betrieb von Maschinenanlagen aufrechterhalten und wirken dabei selbst als willenlose Elemente größerer Maschinenanlagen. Obwohl einige der gezeigten Anlagen heute zwar antiquiert wirken, was aufgrund des Alters dieses Films nicht überrascht, kann der im Film dargestellte menschenähnliche Roboter, der die Rolle der bösen Maria übernimmt, durchaus auch heute noch beeindrucken.
Zurückblickend sind mir noch einige Dialoge aus dem Film „2001 Odyssee im Weltraum“ von Stanley Kubrick aus dem Jahre 1968 in Erinnerung geblieben. Der sprechende und sehende Computer HAL 9000 steuert ein Raumschiff auf einer Expedition zum Jupiter. HAL 9000 galt als unfehlbar, entwickelt aber nach einer Störung ein Eigenleben und tötet 4 der 5 Astronauten. Der Astronaut Dave Bowman kann sich als einziger nur mit knapper Not retten und später die höheren Funktionen dieses Computers abschalten. Bis zu diesem Zeitpunkt bezieht der Film eine besondere Spannung von der Auseinandersetzung des Astronauten mit dem Computer, die in sehr emotionalen Aussagen der Maschine endet. Das Drehbuch zu diesem Film wurde von Kubrick und Arthur C. Clarke, einem Physiker und Science-Fiction Schriftsteller, geschrieben.
“Blade Runner“, ein Film aus dem Jahr 1982 des Regisseurs Ridley Scott stellte das Mensch-Maschinen Verhältnis ambivalenter dar. In einer dunklen Zukunft, wo sich manche menschenähnliche Roboter nicht mehr von Menschen unterscheiden lassen, geht es um eine Auseinandersetzung zwischen Mensch und Maschine. Dabei verschieben und überlappen sich die Rollen der Akteure im Verlauf des Films, wo menschenähnliche Maschinen um ihre Existenz kämpfen. Der Film greift als Vorlage auf den Roman „Träumen Androiden von elektrischen Schafen?“ von Philip K. Dick zurück.
Dagegen ist im Film „Terminator“ aus dem Jahr 1984 des Regisseurs und Drehbuchautors David Cameron die Rolle des Roboters, der Jagd auf einen Menschen macht, auf Bedrohung ausgerichtet. Dieser Roboter stellt eine übermächtige Gefahr dar,. Es geht dabei auch um das Überleben der Menschheit im Kampf gegen Maschinen. Beeindruckend sind einige Szenen, wo der Zuschauer die Welt aus der Roboterperspektive sieht. In der Fortsetzung dieses Films, „Terminator 2“ aus 1991 vom selben Regisseur, übernimmt dieses Robotermodell, gespielt vom selben Schauspieler Arnold Schwarzenegger, nun die Rolle des Beschützers im Kampf gegen noch fortschrittlichere Roboter.
Ohne Gewaltszenen kommt dagegen der Film „Der 200 Jahre Mann“ von Chris Columbus aus dem Jahr 1999 aus und setzt sich dabei positiv von vielen dystopischen Varianten dieses Genres ab. Der Film geht auf eine Erzählung des Biochemikers und Autors Issac Asimovs zurück. In einer Zukunft, wo Androiden als Haushaltshilfen eingesetzt werden, fällt ein Androide mit besonderen Fertigkeiten auf, der immer stärkere menschliche Züge annimmt und sich im Laufe seines Lebens auch äußerlich zu einem Menschen umformen lässt. Dabei geht er bis zur letzten Konsequenz, indem er seinen Körper so verändert, dass er auch altert und damit seine Unsterblichkeit als Maschine freiwilligt aufgibt, um ein Mensch zu werden. Wir erfahren in diesem Film auch etwas über Robotergesetzte, die Asimov 1942 in der Erzählung Runaround postulierte. In „I, the Robot“ von Alex Proyas aus dem Jahr 2004, wird das Roboterthema auf Grundlage des gleichnamigen Buches von Asimovs ebenfalls aufgegriffen.
Eine andere Art von Maschinen sind virtuelle Maschinen, welche man sich auch als Simulationen vorstellen kann. Einfache virtuelle Maschinen gibt es z.B. als Programme, die ein Betriebssystem abbilden und dessen Funktionen „simulieren“. Eine wesentlich komplexere Variante findet man in der Science Fiction mit virtuellen Welten. Dabei schlüpfen Menschen oft in künstliche Rollen, zumindest was ihre körperliche Präsenz angeht und agieren als Teil einer virtuellen Welt.
„The 13th Floor – Bist du was du denkst?“ ist ein deutsch-amerikanischer Film aus 1999 und beschäftigt sich mit virtueller Realität. Zunächst glaubt der Zuschauer in dem Film, einen „realen“ Wissenschaftler zu sehen, der eine virtuelle Welt über eine Computersimulation erschaffen hat, wo Menschen Rollen in dieser Simulation übernehmen können. Als sich später zeigt, dass dieser Wissenschaftler selbst nur Teil einer Simulation innerhalb einer übergeordneten virtuellen Welt ist, stellten sich die Frage nach den Grenzen von Realität und Vision. Davor gab es schon den zweiteiligen Film aus dem Jahr 1973 von Rainer Werner Fassbinder, „Welt am Draht“. Interessant der Vergleich zwischen beiden Filmen, wo der letztere fast ganz ohne besondere Effekte auskommt. Beide Filme beziehen sich auf den 1964 veröffentlichen Roman „Simulacron-3“ von Daniel F.Galouye.
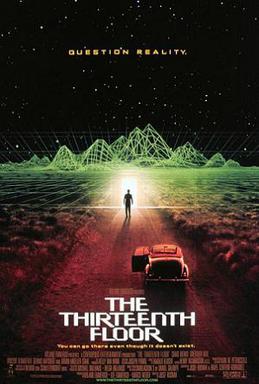
Aus dem gleichen Jahr ist der Film „Matrix“ von den Geschwistern Wachowski, die auch das Drehbuch schrieben.
Zunächst beginnt dort auch die Handlung in einer scheinbaren Realität, bis sich herausstellt, dass die gezeigte Realität nur eine virtuelle Welt ist, in der übermächtige Maschinen die Kontrolle über die Menschen haben. Das tatsächliche Leben in einer mittlerweile zerstörten Umwelt bleibt dabei den meisten Menschen verborgen, da sie nur als „Nutzmenschen“ zur Energieerzeugung in künstlichen Farmen gehalten werden (Anmerkung: Hier wird indirekt auch die Frage nach der Energieeffizienz eines Menschen bzw. lebenden Organismus aufgeworfen).
In „Avatar“, ein Film von James Cameron aus dem Jahr 2009, geht es weniger um virtuelle Welten, als vielmehr um die Möglichkeit einen künstlichen Körper, ein sogenannter Avatar, über Gedankenübertragung zu steuern. Mithilfe dieses künstlichen Körpers soll auf einem lebensfeindlichen Planeten Kontakt mit Eingeborenen hergestellt werden, um damit eine Katastrophe zu verhindern. Ein behinderter Soldat, der in der neuen Umgebung mit Hilfe des neuen Körpers nicht mehr benachteiligt ist und zum Helden aufsteigt, zeigt die positiven Optionen der neuen Technologien. Bemerkenswert auch, dass nach Angaben des Regisseurs mehr als die Hälfte des Films mit dem Computer generiert wurde.
Der Film „Transcendence“ von Wally Pfister aus dem Jahr 2014 mit Johny Depp in der Hauptrolle befasst sich auch mit einer virtuellen Welt. Es geht dabei um den Wissenschaftler Dr. Will Caster, der prognostiziert, daß ein KI-System eine technologische Singularität erreichen werde, eine Art maschinelle Superintelligenz, die der menschlichen Intelligenz überlegen ist und sie obsolet machen würde. Im Unterschied zu den vorangegangen Filmen, verliert der Protagonist Dr. Will Caster durch einen Mordanschlag sein Leben und wird als virtuelles Wesen ins Netz gebracht. Nun kontrolliert er nicht mehr als ein physisch präsenter Mensch das Tun in einer virtuellen und realen Welt, sondern nur das, was von ihm ins Netz übernommen wurde. Nun kann spekuliert werden, wieviel „Mensch“ als nicht-physische Wesen verblieben sein kann (z.B. im Vergleich zu den Maschinen im Film „Bladerunner“). Hinzukommt die Spekulation um eine technologischen Singularität.
Diese Beispiele sollen einerseits Mensch-Maschine Beziehung aus verschiedenen Perspektiven zeigen, aber auch Beziehungen zu virtuellen Welten.
Virtuelle Welten
Das Besondere an den Virtuellen Welten in diesen Unterhaltungsfilmen ist ihr Realitätsgrad und in diesen Beispielen, ihre Verschachtelung. Der Unterhaltungsfilm ist in der Regel fiktiv und spielt immer bis zu einem gewissen Grad in einer virtuellen Welt. Das Science-Fiction-Genre unterstreicht den fiktiven Charakter des Films und entfernt sich möglicherweise weiter von einer Realität. Wenn nun der Gegenstand im Film selbst wieder eine virtuelle Realität ist, die von einer virtuellen Realität geschaffen wird, verschwinden die Grenzen zwischen Schein und Wirklichkeit.
Aber es gibt natürlich viel einfachere Beispiele, wie man z.B. bei Kindern und Jugendlichen sieht. Diese kommen oft schon sehr früh mit intelligenten Spielzeugen oder Handy-Spielen in Berührung, wo sie mit ihrer kindlichen Phantasie in virtuellen Welten eintauchen können. Auch in der Praxis gibt es hier viele Beispiele zur Anwendung virtuelle Welten, wie Simulationen von Fliegen oder Rennwagen fahren, bei denen eine visuelle Darstellung wichtig ist. Oder möglicherweise Computerprogramme, die die Entwicklung von Aktienkursen in Abhängigkeit von Einflussgrößen simulieren. Aufgrund der fortschreitenden technischen Entwicklung einschließlich verbesserter Interaktionsmöglichkeiten zwischen Mensch und Maschine, wird sich dieser Bereich schnell weiterentwickeln.
Mensch-Maschine Verhältnis
Eine wesentliche Frage beim Mensch-Maschine Verhältnis wird sein, in welcher Weise wir zukünftig miteinander agieren und wie sich dieses Verhältnis weiterentwickeln soll. Das gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche. Mittlerweile können wir auf einfache Weise im privaten Bereich Erfahrungen sammeln, in dem wir z.B. über Sprache mit einigen Anwendungen kommunizieren. Aber auch Dienstleistungen, wie z.B. über Hotlines, werden immer stärker über Sprachassistenten gesteuert. Hier steckt noch ein großes Potential für die zukünftigen intelligenten Maschinen –oder Kunstwerke. Aber auch für viele offene Fragen.
Zusammenfassung
Interessanterweise stellen sich diese beschriebenen Aspekte als mehr oder weniger realistisch oder phantastisch dar. Aber man kann sich anhand weniger Beispiele vorstellen, dass es innerhalb der letzten 100 Jahre erhebliche Fortschritte gab, die sich vermutlich noch weiter beschleunigen werden. Die weiterentwickelten, mit KI ausgestatteten Computer oder Roboter, nähern sich immer stärker einigen in der Vergangenheit gezeigten, damals visionären, Filmbeispielen an. Diese Tendenz hält an. Weiterentwickelte Schnittstellen zur Kommunikation u.a. zwischen Menschen und Maschinen, oder auch untereinander, die man früher noch als Telepathie (Anhang) bezeichnet hätte, wird durch den Technikeinsatz immer mehr zur einer Realität. Während vielleicht grundsätzliche Fragen nach dem Wesen des Menschsein auch in Zukunft eine Frage des Glaubens bleiben werden, hat die Frage nach einer technologischen Singularität heute größeres Realitätspotential.
Persönliches Fazit
Dieser einwöchige Ausflug in die Science Fiction war sehr interessant. Aus zeitlichen Gründen konnten sich diese Betrachtungen nur auf einen kleinen ausgewählten Ausschnitt, nämlich dem Maschinenthema beziehen, zu dem es Bezüge zur Informatik gibt. Das Science Fiction Genre bietet natürlich wesentlich mehr ,und ich könnte mir auch andere Gedankenspiele vorstellen, die anderen Wissensbereichen zuzuordnen sind. Gerne hätte ich mir noch weitere Filme angesehen, das Themenspektrum erweitert oder bestimmte Darstellungsformen, wie z.B. der Einbeziehung von Musik, genauer betrachtet. Aber auch so hat es mich motiviert, die betrachteten Themen weiter zu vertiefen.
Hervorheben bei diesen Betrachtungen möchte ich den Begriff der Technischen Singularität (siehe weiter unten), der im letzten Film ein Gegenstand war und die heutige Diskussion um KI besser auf den Punkt bringen könnte. Weiterhin ist es wichtig den aktuellen Stand der Technik so weit zu verstehen, dass man zwischen Glauben und Wissen besser unterscheiden kann. Wie weit sind heute wirklich zukunftsweisende Projekte, wie sie z.B. das Unternehmen Neuralink macht. Das von Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink beschäftigt sich mit einer Mensch-Maschine Schnittstelle (Brain-Computer-Interface) . Damit zusammen hängt auch die etwas allgemeinere Frage nach der Zukunftsforschung, bzw. der Wissenschaftlichkeit dieses Bereichs.
Als Anlaufstelle für Begriffsdefinitionen, Diskussionen und weiterführende Verweise habe ich als Fachfremder ausreichend Gebrauch vom Wikipedia Portal gemacht. Insbesondere für folgende Begriffe, zu denen auch der entsprechende Link hinterlegt ist.
Film, Filmgeschichte, Fiktion, Abbild,
Wissenschaft, Informatik, Zukunftsforschung, Technologische Singularität.
Maschine, Computer, Roboter, Künstliche Intelligenz,
Vielen Dank an die vielen Helfer, die dieses Portal unterstützen.